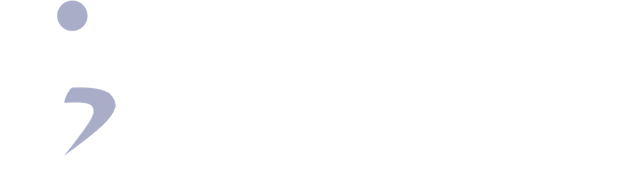Arthroskopische Chirurgie
Die arthroskopische Chirurgie des Sprunggelenkes hat sich in den letzten Jahren zu Standardverfahren in der Orthopädie und Traumatologie entwickelt und kann für eine Vielzahl von Verletzungen und Pathologien angewendet werden. Sowohl akute Verletzungen wie Gelenksfrakturen, Syndesmosenrupturen, akute osteochondrale Frakturen und Bandrupturen als auch chronische Pathologien wie Impingement, Gelenksteife chronische Bandrupturen und osteochondrale Läsionen können heutzutage arthroskopisch oder arthroskopisch assistiert versorgt werden.
Frakturbehandlung
Frakturen des Sprunggelenkes sowie der Fußwurzel sind nach Trauma im Rahmen von Sport- oder Arbeitsunfällen häufige Verletzungen. Am häufigsten ist dabei die Sprunggelenksgabel betroffen. Hier können alle gelenksbildenden Anteile betroffen sein (Aussenknöchel, Innenknöchel, hinterer Rand der Tibia / sog. Volkmann-Dreieck). Je nach Fraktur sowie Alter und Aktivitätsniveau wird individuell entschieden, ob eine konservative Therapie mit Ruhigstellung im Gipsverband oder Walker-Stiefel möglich ist oder ob eine operative Behandlung mit arthroskopisch assistierter oder offener Reposition und Fixation mit Titanschrauben oder Platten erforderlich ist. Bei den nicht seltenen Kombinationsverletzungen mit Bandrupturen oder Syndesmosenruptur, können diese in gleicher Sitzung mit Nähten oder Anker und Faden-Flaschenzug-Systemen (Tight-Rope) stabil versorgt werden. Bei vermehrter Krafteinwirkung kann auch das Sprunggelenksdach betroffen sein. Diese Pilon-Frakturen sind häufig stark zertrümmert und müssen fein rekonstruiert werden, um einer späteren Arthroseentwicklung entgegenzuwirken. Hierzu kann nicht selten auch eine Knochentransplantation mit eigenem oder Spenderknochen oder Knochenersatzmaterial erforderlich werden, um die Gelenksflächen gut abzustützen. Dazu kann auch bei Knorpeldefekten eine chondrogene Matrix erforderlich sein, um eine Regeneration zu erzielen. Frakturen der Fußwurzelknochen wie Sprungbein oder Fersenbein betreffen sehr häufig eine oder mehrere Gelenksflächen und müssen daher auch bei nur geringen Verschiebungen operativ versorgt werden, um Spätfolgen zu vermeiden. Dazu werden häufig nur Titanschrauben verwendet, in manchen Fällen wie bei komplexen Fersenbeinfrakturen muss jedoch über einen größeren Zugang der Knochen mithilfe von Titanplatten rekonstruiert und stabil fixiert werden. Wichtig ist eine Übungstabilität zu erreichen, damit es nicht zu eine posttraumatischen Gelenksteife kommt. Frakturen der Mittelfußknochen und Zehen können nicht selten konservativ behandelt werden. In manchen Fällen jedoch, bei starker Verkürzung, Achsabweichung oder Rotationsfehlstellung ist eine operative Versorgung mit Schrauben und Platten erforderlich. Ein Sonderfall nimmt hier die Jones-Fraktur im Basis-Bereich des 5. Mittelfußknochen ein. Bedingt durch eine kritische Durchblutung im Frakturbereich ist eine Heilung bei konservativer Therapie nicht regelhaft gewährleistet und die Entwicklung einer Pseudarthrose keine Seltenheit. Daher sollte diese Fraktur mit einer Verschraubung behandelt werden.
Nach Abschluss der knöchernen Heilung können die Implantate bei mechanischer Störung im Rahmen eines Zweiteingriffes entfernt werden. Eine generelle Empfehlung für eine Entfernung kann heutzutage jedoch nicht mehr ausgesprochen werden, diese wird individuell entschieden.
Häufige Probleme des Sprunggelenks:
Weitere Fragen?
Die ExpertInnen des Sportambulatorium Wien sind gerne für Sie da
Einfach anrufen!